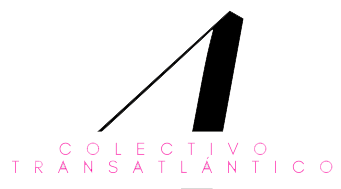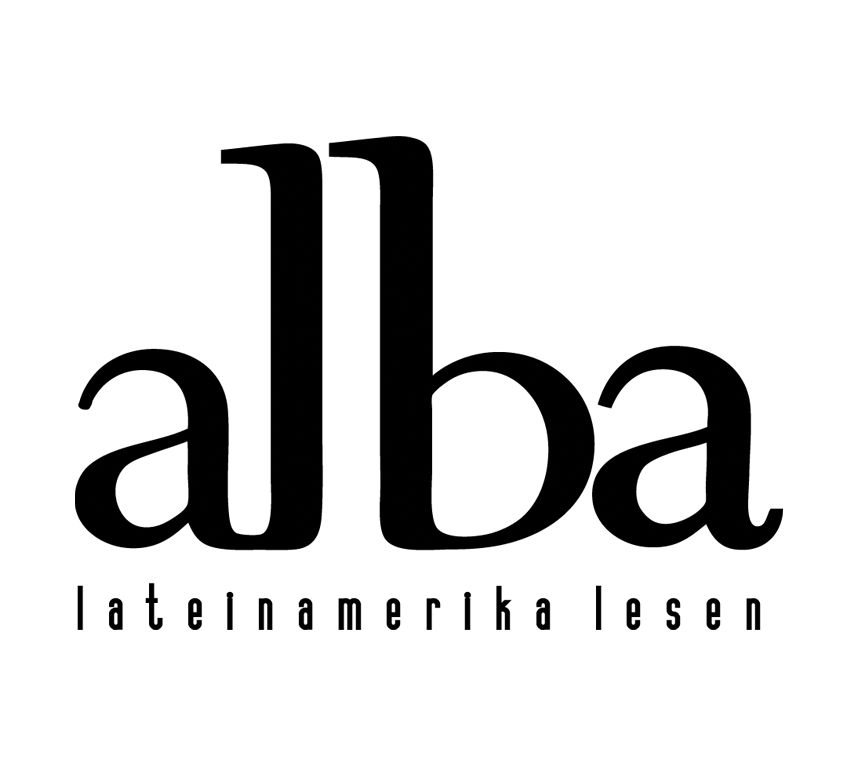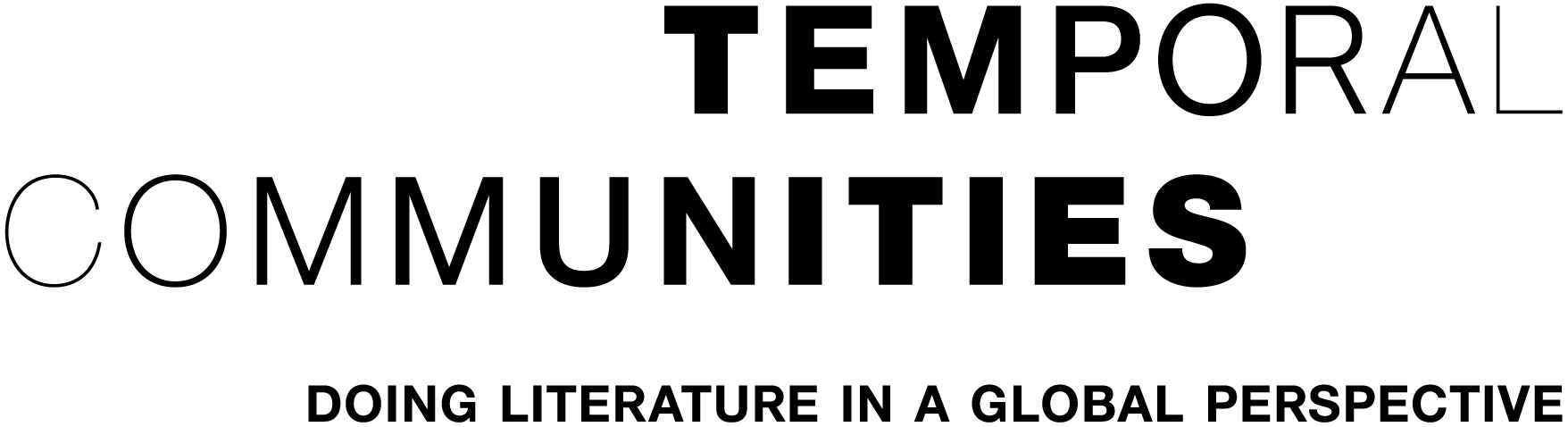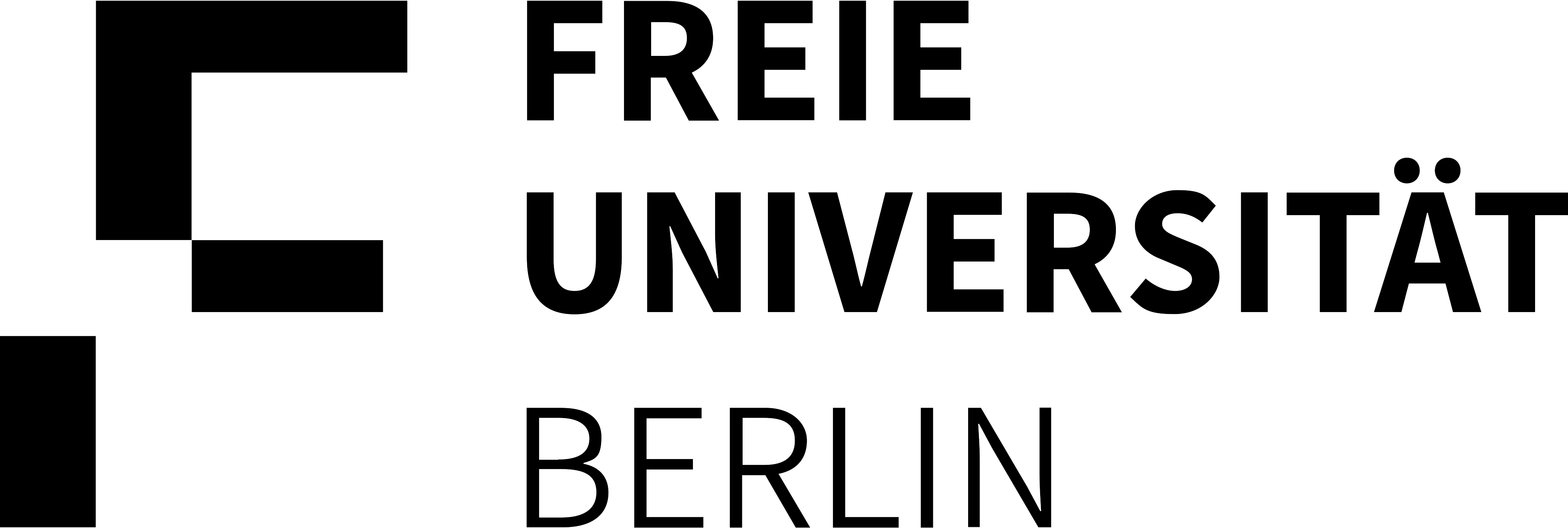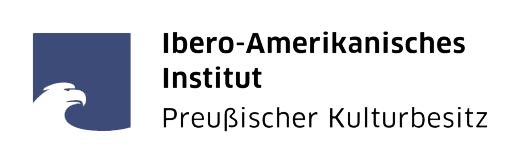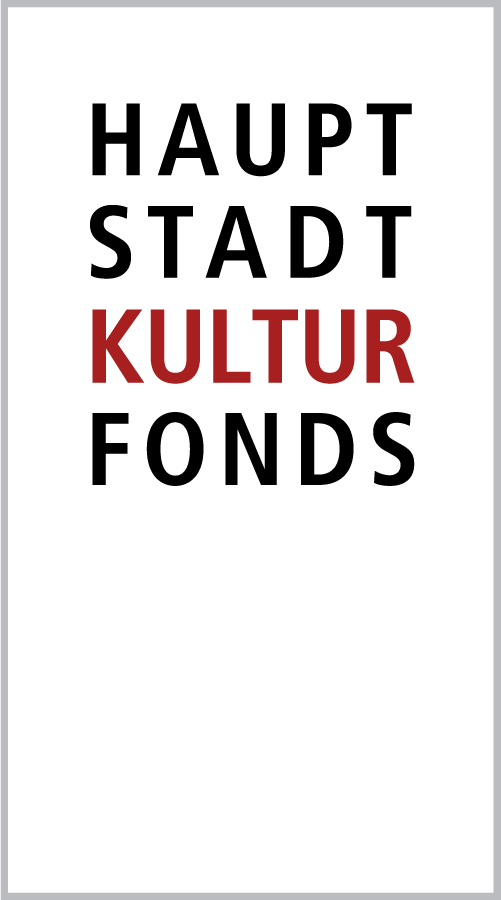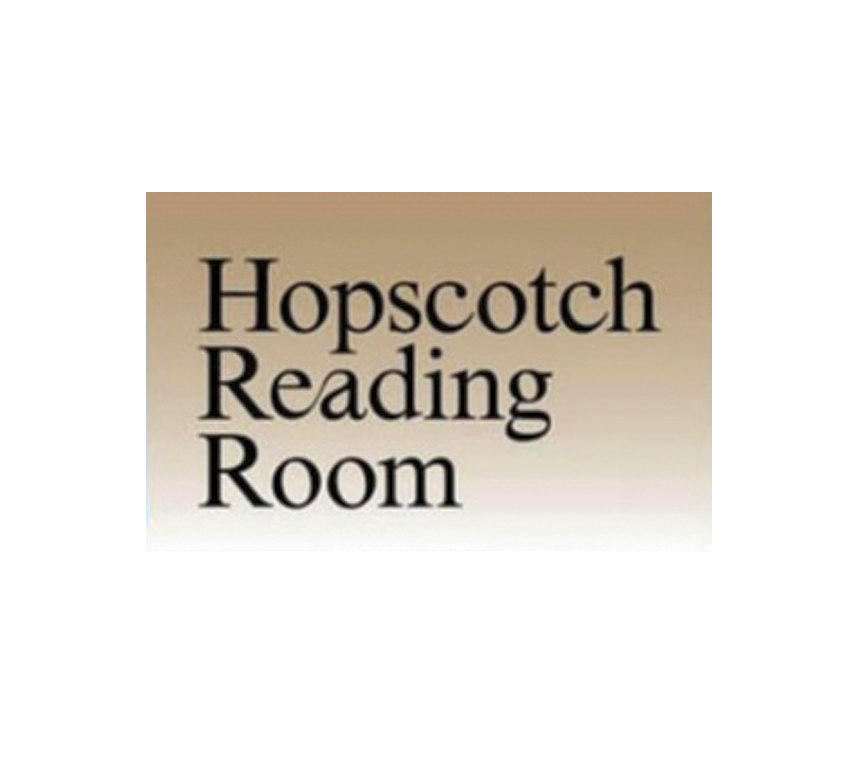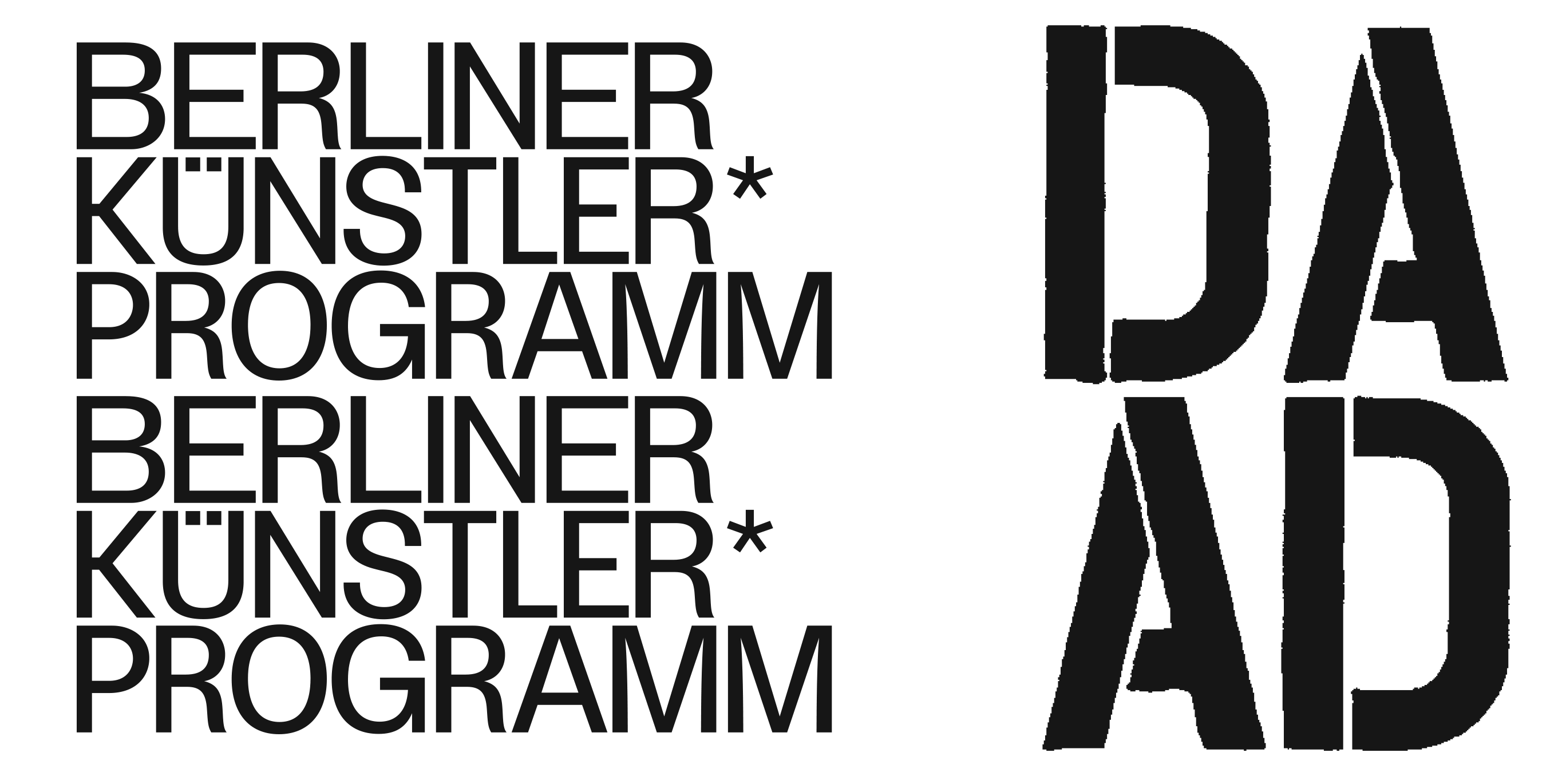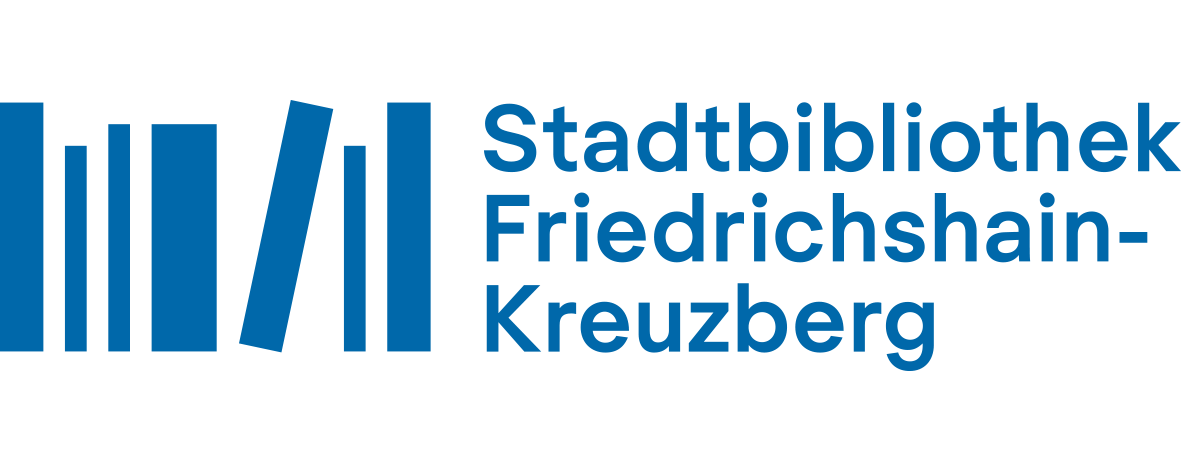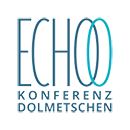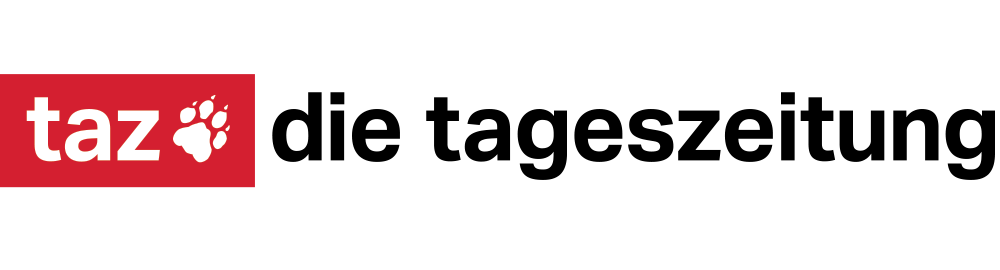Lateinamerikanisches
Literaturfestival
Programm
15:00 — 16:00

Lesung und Ausstellungseröffnung (dt/sp)
Mit Sandra Rosas und Tomás Cohen
Momente des Übergangs, kleine Fluchten, Blickwechsel markieren das poetische Terrain des chilenischen Dichters Tomás Cohen, der ein sehr genauer Beobachter von Details ist. Die Dichterin Sandra Rosas schreibt über den mal beklemmenden, mal zum Träumen einladenden Alltag einer Frau in Mexiko. Gemeinsam mit ihren Übersetzerinnen Luisa Donnerberg und Timo Berger stellen sie ihre Werke vor. Parallel eröffnet eine Ausstellung mit Büchern von in Berlin lebenden lateinamerikanischen Autoren aus den Beständen der Bibliothek.
Moderation: Timo Berger (Übersetzer und Kurator der Latinale) und Luisa Donnerberg (Übersetzerin und Redakteurin alba.lateinamerika lesen)
Im PopUp
19:00 — 20:00

Festivaleröffnung, Lecture-Performance und Gespräch (dt/pt)
Mit Ricardo Domeneck
Berlin ist für viele lateinamerikanische Künstler:innen und Schriftsteller:innen, die in der Stadt Zuflucht gefunden haben, ein Ort der Andersartigkeit. Der aus Brasilien stammende Dichter, Essayist und Übersetzer Ricardo Domeneck hinterfragt koloniale Machtstrukturen und blickt auf die kulturelle Dynamik und die Einflüsse der lateinamerikanischen Diaspora, um zu reflektieren, wie postkoloniale Identitäten in Berlin neu geformt und erlebt werden.
Moderation: Hernán D. Caro (Freier Journalist)
Videodesign: Rocío Rodriguez
Die Veranstaltung wird simultan gedolmetscht.
19:30 — 21:30

Gespräch (sp)
Mit Ana S. Pareja und Gabriela Wiener
kuratiert von Bartleby & Co.
Eintritt frei + Voranmeldung nötig: bartlebyberlin@gmail.com
Maximal 40 Teilnehmende
Die Autorin Gabriela Wiener und die Verlegerin und Buchhändlerin Ana S. Pareja erzählen die Geschichte einer Freundschaft, die Anfang der 2000er Jahre in Barcelona geschlossen wurde:
„Dies sollte eigentlich ein Gespräch über die Literatur der Schriftstellerin Gabriela Wiener werden, wurde es aber nicht. Fast wäre es ein Gespräch über Ana S. Pareja geworden, der Buchhändlerin von Bartleby & Co. Inspiriert von den Romanen von Elena Ferrante wollten wir es „Meine spanische Freundin“ nennen. Aber mit der Zeit wurde uns klar, dass dieses Gespräch nur ein Stück gemeinsames Leben sein konnte, das auf einer unbeantworteten Frage aufbaut: Können sich zwei junge Frauen, die eine peruanisch, ohne Papiere, prekär und rassialisiert, die andere europäisch, weiß, aus einer sorglosen Familie, wirklich begegnen?
Nachdem sie sich kennengelernt haben, ist die Freundschaft und Bindung sofort da, aber der Prozess der Assimilation dieser beiden Leben ist, wie erwartet, brisant. Sie werden sich lieben, hassen, sich Gedichte schreiben, im Morgengrauen am Telefon weinen, gemeinsam Bücher herausgeben, wachsen und reifen, und das Leben wird sie an fast entgegengesetzte Orte führen. Die eine bleibt in Spanien, schafft es, ihren Status zu legalisieren und als Schriftstellerin berühmt zu werden, die andere zieht nach Deutschland, verliert ihren Status als erfolgreiche Verlegerin und erlebt die innereuropäische Migration in ein Land, das viel weiter nördlich liegt, als es ihr lieb ist. Beide sind Mütter. Beide wollen schreiben und ewigen Ruhm erlangen. Die Liebe ist nach zwei Jahrzehnten immer noch intakt, aber Konflikte und Explosionen sind immer nur eine E-Mail entfernt. „Du kamst mir vor wie eine Hochstaplerin und eine Schwindlerin“, so lautet der Titel des Interviews, das Gabriela Ana für ihr Buch „Dicen de mí“ gibt. In einer anderen Antwort sagt Ana ihr: „Du hast mich dazu gebracht, mir Gedanken über meine Schroffheit zu machen“.
Vielleicht liegt die Antwort auf dieses und andere Missverständnisse in diesem Dialog aus Liebe in Zeiten der Cholera: „Und wie lange, glaubst du, können wir mit diesem verdammten Hin und Her weitermachen?“ fragte sie. Ihre Freundin hatte die Antwort schon seit zwanzig Jahren, sieben Monaten und elf Tagen und Nächten parat: „Mein ganzes Leben“.
In dieser Veranstaltung in Berlin werden sie sich wieder live treffen, um die x-te Abrechnung ihres Lebens vor dem Publikum in einem Gespräch im Prozess der Dekolonisierung zu machen, ohne Übersetzung ins Deutsche, für die spanischsprachige Gemeinschaft in Berlin.
Mit Ihnen, Gabriela Wiener und Ana S. Pareja.“

17:00 — 20:45
Performance, Lesung, Installationen und Gespräch (sp/dt)
Mit Juan Ignacio Chávez, Paloma Zamorano Ferrari, André Felipe und Ludmila Fuks
Die umfangreichen Bestände des Ibero-Amerikanischen Instituts (IAI) in Berlin sind nicht nur ein Wissensarchiv, sondern auch ein lebendiger Raum für neue Geschichten. In einem Labor arbeiteten der Schriftsteller Juan Ignacio Chávez, der Dramaturg André Felipe, die Künstlerin Paloma Zamorano Ferrari und die DJane und Klangkünstlerin Ludmila Fuks zusammen, um das kreative und politische Potenzial des Archivs hervorzuheben. Die Ergebnisse des Labors werden in Performances, Klanginstallationen, Lesungen und anderen Formaten präsentiert.
Moderation: Verónica Paula Gómez (Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin)
Konzept und Organisation: Ana Rocío Jouli (EXC 2020)
Kuratorische Assistenz: Andrés Gorzycki
Die Veranstaltung wird simultan verdolmetscht.
Eine Kooperation mit dem Exzellenzcluster „Temporal Communities: Doing Literature in a Global Perspective“ und dem Ibero-Amerikanischen Institut
Künstler:innen

Gabriela Wiener

Lola Arias

Ricardo Domeneck

I Acevedo
Gabriela Wiener
Foto: privat
Lola Arias
Foto: Cherie Brikner
Ricardo Domeneck
Foto @ Paul Mecky
I Acevedo
Foto: Marla Zakai