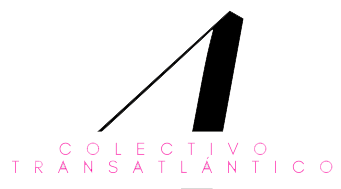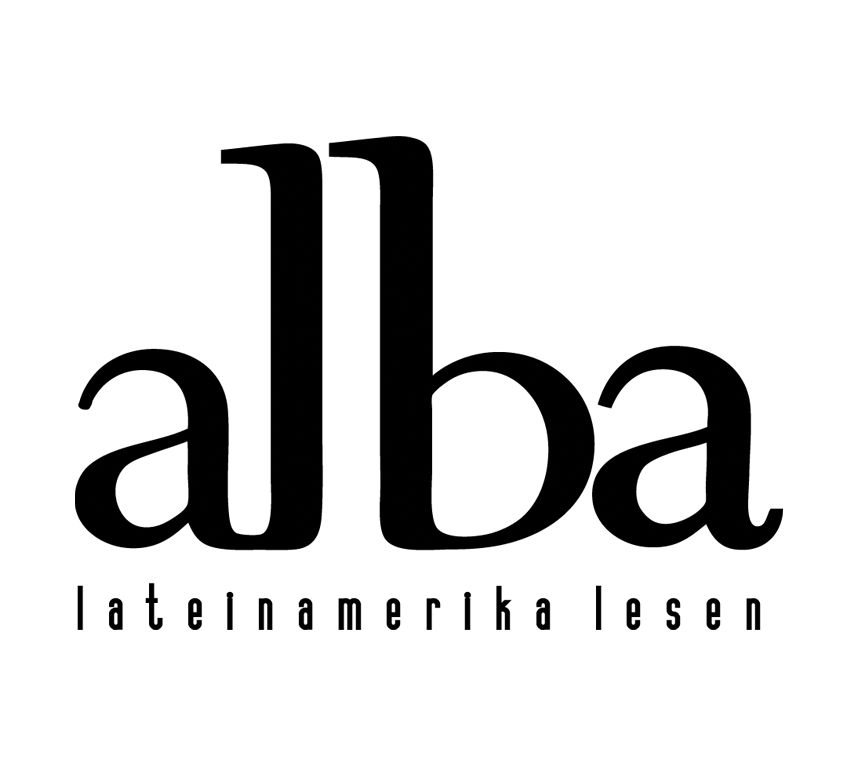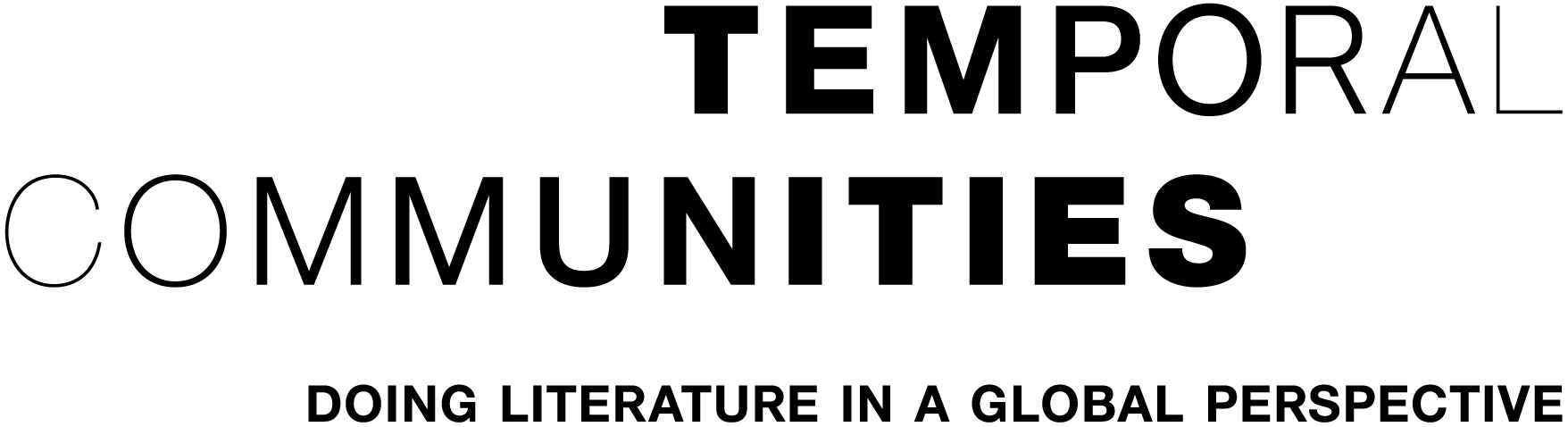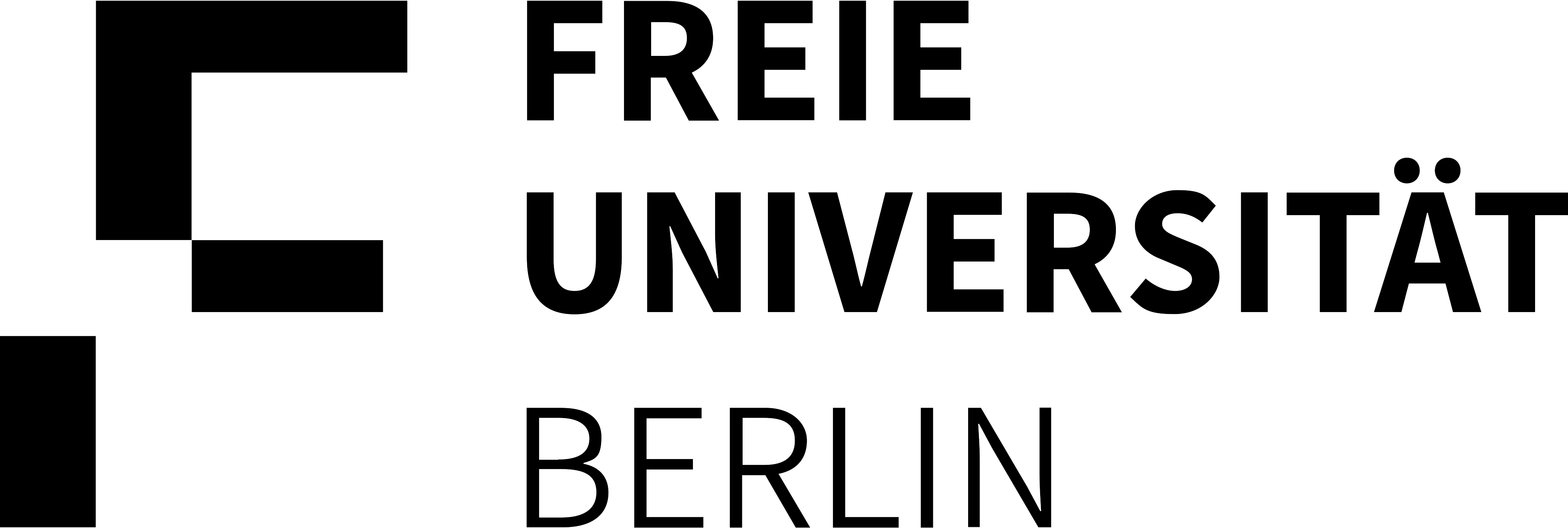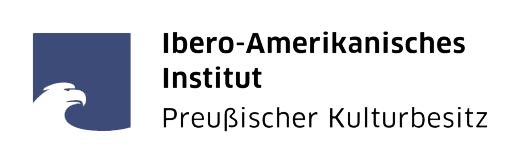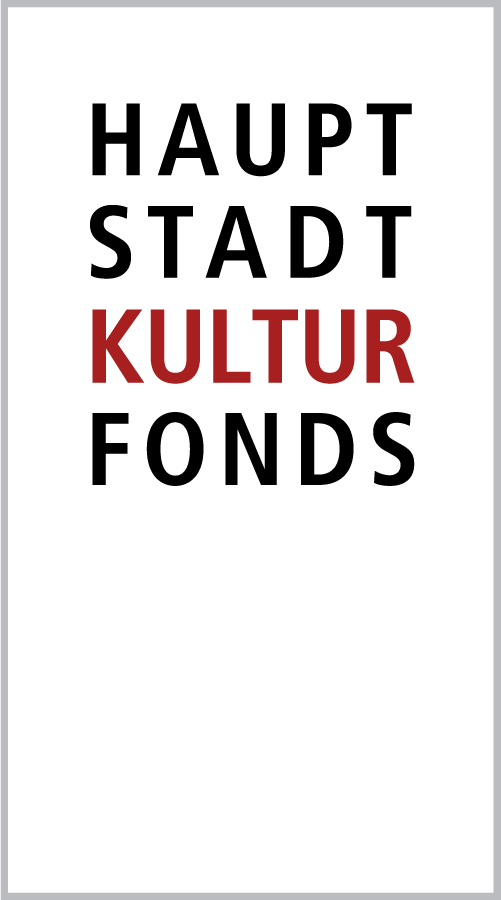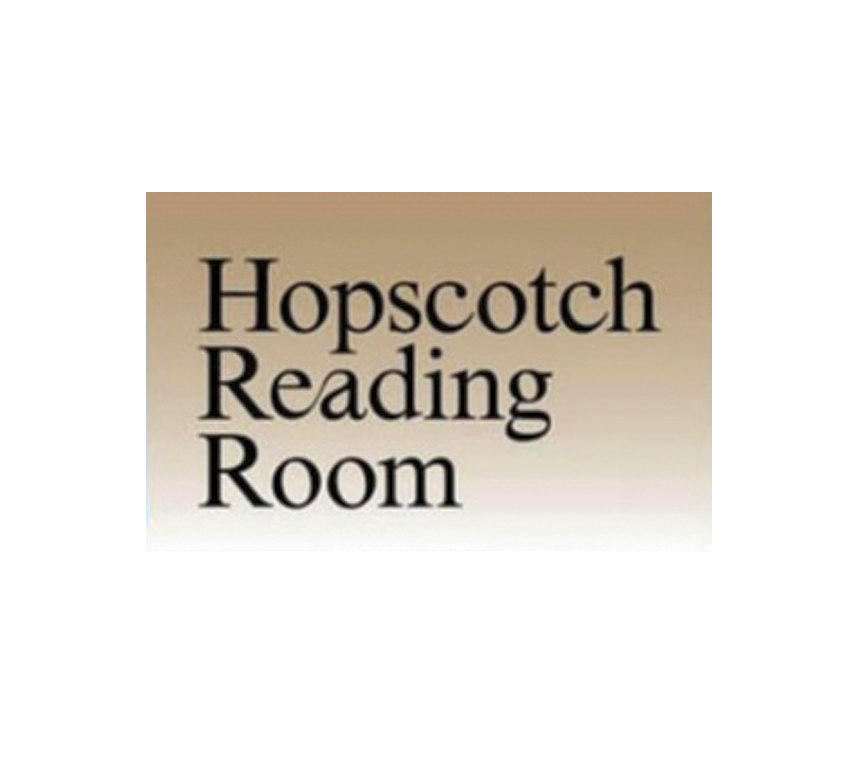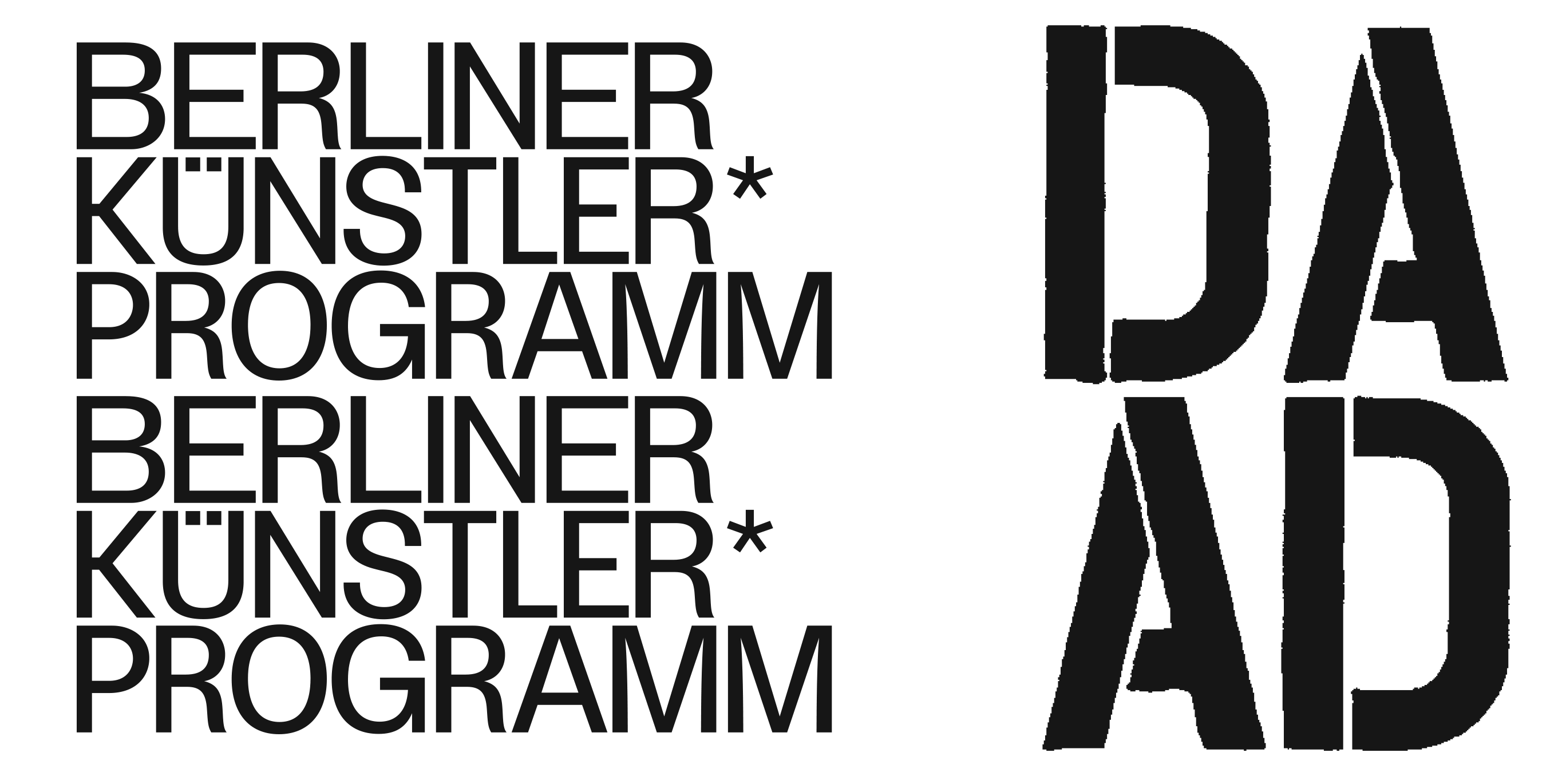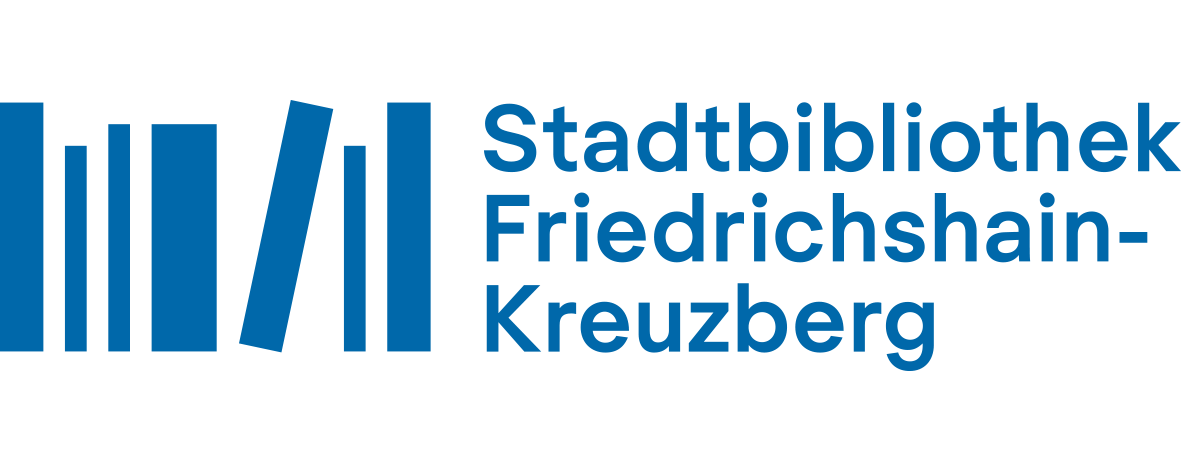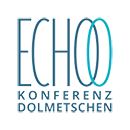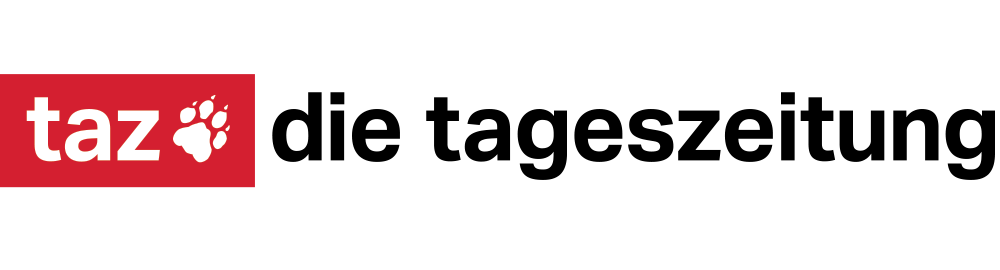Text & Bild
Was machen wir noch hier? Berlin ist auch eine textuelle Viertel aus Lateinamerika. Texte, Bilder und Sinngewebe über aus/in und zum Barrio (Bairro) kommen hier zu Wort.
Barrio I Bairro Berlin
Barrio I Bairro Berlin
Der Blick auf Lateinamerika ist nach wie vor stark durch koloniale Stereotype und exotisierende Narrative geprägt, und die Literatur des Magischen Realismus prägte zusätzlich das Bild eines entrückten, ländlichen Lateinamerikas. Die zeitgenössische lateinamerikanische Literatur widersetzt sich diesen Narrativen. Mit einer großen stilistischen Vielfalt entziehen sich die Autor:innen jeder Kategorisierung. Sie mischen Genres wie Science-Fiction, Thriller, Fantasy, Memoria und utopische Literatur und entwickeln neue Textformen wie die „microrrelato“, die Mikroerzählung und Dokumentarpoesie. Jenseits der verklärten Utopien der Literatur des Magischen Realismus, der die Folgen des Kolonialismus und die gesellschaftlichen und politischen Realitäten der modernen lateinamerikanischen Gesellschaften ausblendet, arbeitet die zeitgenössische Literatur koloniale und postkoloniale Verwerfungen auf und denkt Lateinamerika dekolonial.